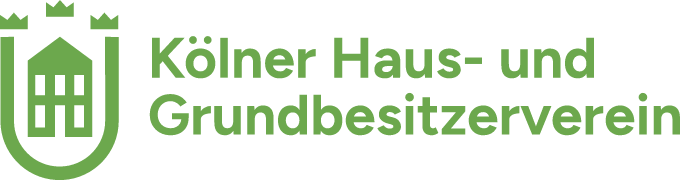Kommt das Klimageld erst 2027?
Haus & Grund will Aufteilung der CO2-Abgabe überprüfen lassen
Ursprünglich sollte das Klimageld als Kompensation für die steigende CO2-Bepreisung ab 2025 eingeführt werden. Nun soll die Einführung aus technischen Gründen erst ab 2027 möglich sein. Haus & Grund Deutschland will unterdessen die Aufteilung der CO2-Kosten zwischen Mietern und Vermietern durch das Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen.
Im 2021 beschlossenen Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP wurde Folgendes vereinbart: „Um einen künftigen Preisanstieg zu kompensieren und die Akzeptanz des Marktsystems zu ewährleisten, werden wir einen sozialen Kompensationsmechanismus über die Abschaffung der EEG-Umlage hinaus entwickeln (Klimageld).“ Hierbei soll das Klimageld den Bürgern ihre Ausgaben für die CO2-Bepreisung in Form einer Pro-Kopf-Pauschale zurückgeben.
Im Jahr 2023 hat der Staat 18,4 Milliarden Euro aus der Bepreisung von CO2-Emissionen eingenommen. Das sind 40 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Besonders stark war der Anstieg mit 67 Prozent bei der Bepreisung von CO2 in den Bereichen Wärme und Verkehr. Das teilte die Deutsche Emissionshandelsstelle mit. Von daher ist nach Auffassung von Haus & Grund ein Klimageld dringender denn je. Die CO2-Bepreisung darf die Bürgerinnen und Bürger nicht übermäßig belasten, sondern soll zu klimafreundlichem Verhalten anreizen. Deshalb müssen die enormen Staatseinnahmen in Form eines Pro- Kopf-Klimageldes an jeden einzelnen Bürger zurückgegeben werden.
Die für den nationalen Emissionshandel zuständige Emissionshandelsstelle geht davon aus, dass die Emissionen im Verkehrs- und Gebäudebereich im vergangenen Jahr gesunken sind. Die Einnahmensteigerung sei auf einen Nachholbedarf bei den Unternehmen zurückzuführen, die den Erwerb von Emissionsrechten von 2022 auf 2023 verschoben hätten.
„Der CO2-Preis wirkt – besser und zielgerechter als jedes andere Instrument. Es ist jedoch nur mit einem von der Ampel-Koalition auch vereinbarten Klimageld vollständig. Mit diesem Klimageld würde ein sozialer Ausgleich geschaffen und die Lenkungswirkung des CO2-Preises hin zu klimaneutralem Verhalten vollständig beibehalten. Wer Klimaschutz ernst nimmt, verzichtet auf Ordnungsrecht und führt das Klimageld endlich ein“, sagte der Präsident von Haus & Grund Deutschland, Dr. Kai Warnecke Anfang des Jahres. Die Rückzahlung würde einkommensschwächere Bürger stärker entlasten, weil sie in der Regel einen kleineren CO2-Fußabdruck hinterlassen als einkommensstärkere Bürger.
Dabei ist das Klimageld vor allem aus Sicht der Vermieter zwingend erforderlich. Seit dem 1. Januar 2023 wird der Vermieter an den CO2-Kosten beteiligt. Die Höhe der Beteiligung richtet sich nach dem Verbrauch des Mieters und dem verwendeten Brennstoff. Die Aufteilung der CO2-Kosten zwischen Vermieter und Mieter erfolgt anhand eines 10-Stufen-Modells. Neben Heizöl und Erdgas erfolgt auch eine Aufteilung der CO2-Kosten für Fernwärme. So funktioniert das Stufenmodell: Bei Wohnungen mit besonders hohen CO2-Emissionen ab 52 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr (kg CO2/m²/a) müssen Vermieter 95 Prozent und Mieter 5 Prozent der CO2-Abgabe tragen.
Je niedriger die CO2-Emissionen pro Quadratmeter Wohnfläche des Gebäudes sind, desto niedriger ist der Anteil des Vermieters an den CO2-Kosten. Der Vermieteranteil sinkt in der besten Stufe mit weniger als 12 kg CO2/m²/a auf 0 Prozent. Sofern Wärme oder Warmwasser aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird, entstehen CO2-Emissionen und die CO2-Abgabe wird fällig. Mieter müssen diese entsprechend ihrem Verbrauch entrichten. Vermieter werden je nach Einstufung des Gebäudes an den CO2-Kosten beteiligt. Die neue Aufteilung zwischen Vermieter und Mieter wird mit den in diesem Jahr erstellten Nebenkostenabrechnungen für den Abrechnungszeitraum 2023 notwendig.
Haus & Grund Deutschland will die gesetzlich vorgeschriebene Aufteilung der CO2-Kosten zwischen Mietern und Vermietern durch das Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen. In den kommenden Monaten dürfte ein geeigneter Fall vorliegen. „Wir haben nicht den Eindruck, dass dieser Maßstab als Begründung sachgerecht ist für die Aufteilung des CO2-Preises“, sagte Dr. Kai Warnecke. Der Vermieter hat keinen Einfluss auf den tatsächlichen Verbrauch durch den Mieter „Wer in einem schlecht isolierten Haus wohnt, zieht sich vielleicht eher einen Pullover an, als die Wohnung auf 21 Grad zu heizen, weil er weiß, dass dafür viel Energie nötig ist. Wer aber weiß, dass das Gebäude gut isoliert ist, ist weniger motiviert zu sparen.“ Am Ende ist der CO2-Ausstoß der Gleiche.
Autor: Ass. jur. Erik Uwe Amaya, Verbandsdirektor Haus & Grund Rheinland Westfalen